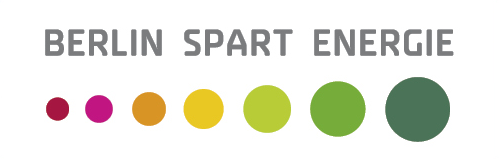Newsletter 8/2019
Rebound-Effekte
Liebe Leserinnen und Leser,
der Berlin-spart-Energie-Newsletter ist zugegebenermaßen kein Krimi. Hier geht es um Energieeffizienz und nicht darum, einen Dieb zu finden. Etwas Detektivarbeit kann jedoch trotzdem ganz spannend sein: Sagen wir einmal die Stromabrechnung fällt ziemlich hoch aus. Wer sind hier die üblichen Verdächtigen? Eigentlich sind im ganzen Haushalt energieeffiziente Technologien im Einsatz. Dementsprechend haben Kühlschrank und LED-Lampen als A++ Geräte ein ziemlich gutes Alibi – eigentlich verbrauchen Sie ja quasi nichts. Vielleicht ist ja die neue Waschmaschine ein heimlicher Energiefresser?
Und was wenn dies auch kein Einzelfall ist? Denn seit 1990 ist der Endenergieverbrauch von Privathaushalten in Deutschland nicht gesunken – im Gegenteil. Weltweit hat sich der Primärenergieverbrauch seit 1970 verdoppelt. Der aktuelle Newsletter sucht nach den verschwundenen Kilowattstunden und begibt sich dazu auf die Spur der Rebound-Effekte.
Eine interessante Lektüre wünschen
Michael Scheuermann, Robert Volkhausen
Ein altes Paradox und die Suche nach dem Motiv
Anfang der 1990er Jahre ging der Ökonom Harry Saunders der Frage von der scheinbar verpufften Energieeffizienz nach. In seiner volkswirtschaftlichen Lesart senken wir mit LED-Leuchtmitteln in unserer Wohnung in erster Linie die Kosten für Raumbeleuchtung. Die frei werdenden Mittel werden oftmals in einen höheren Konsum der gleichen Ware investiert – also mehr Leuchten. Oder man gönnt sich mit den eingesparten Heizkosten eine Reise in die Südsee. Saunders wollte es genauer wissen und verwendete 20 Jahre Detektivarbeit darauf, diesen Effekt gesamtgesellschaftlich zu modellieren.
Neu war diese Erkenntnis keineswegs: Schon in den 1860er Jahren hatte sich William Jevons mit der Kohlenutzung für Dampfmaschinen beschäftigt und stellte fest, dass die effizientere Nutzung der Kohle durch verbesserte Dampfmaschinen den Verbrauch rapide ansteigen ließ.
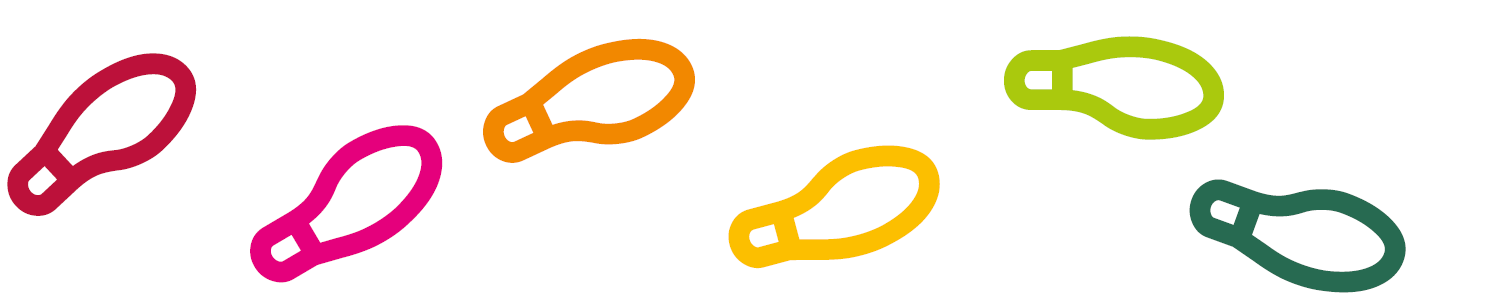
Eine Wette auf die Zukunft
Heute sind diese Phänomene als Rebound-Effekte bekannt und bezeichnen den Anteil des theoretisch erreichbaren Einsparpotenzials von Effizienzsteigerungen, der wegen des Verhaltens der Verbraucher*innen in der Realität nicht eingespart wird. Streit gibt es nach wie vor darüber, wie groß dieser Effekt genau ist und ob im schlimmsten Fall eine Ware so günstig wird, dass Bemühungen nach hinten losgehen. Letztlich berührt das auch das Erreichen von Klimazielen der Energiewende, denn die meisten Prognosen preisen auch Effizienzgewinne in der Zukunft mit ein.
Projekt des Monats: EE-Rebound
Die Gründe und Ursachen spielen bei unserem Projekt des Monats eine Rolle: Im EE-Rebound-Projekt wollen Forscher*innen herausfinden, wie sich das Verbrauchsverhalten von Haushalten ändert, wenn sie auf erneuerbare Energien umsteigen.
Knapp umschrieben geht es um die Frage, ob ein Umsteig auf erneuerbare Energien ein Alibi für einen vergleichsweise ineffizienteren Umgang mit Energie liefert und zu Rebounds führt – oder ob eine Sensibilisierung für das Thema zu Suffizienz- und Spill-Over Effekten führen. Ziel ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Praxis und Politik.
Wie viel ist quasi Nichts?
Die üblichen Verdächtigen bei Untersuchungen sind die direkten Rebounds – vor allem in den Bereichen Raumwärme, Beleuchtung und Individualverkehr. Wieviel Rebound in jeder Effizienzsteigerung steckt, ist jedoch umstritten. Bei Beleuchtung ist Konsens, dass es sich um maximal rund 10 Prozent handelt. Bei Wärme und Verkehr schwanken die Werte vom einstelligen Bereich bis hin zu Annahmen von über 60 Prozent. Das Umweltbundesamt hält jedoch maximal 30 Prozent Rebound für realistisch.
Schwieriger sind die Ermittlungen bei indirekten Rebounds und bei makroökonomischen Effekten: Eine neue Heizung gegen eine Flugreise rechnen? Kommt ganz darauf an, wie sehr man im Winter friert und ob man tatsächlich anstatt der Reise etwas anderes Effizientes gemacht hätte. Eine Messung ist oftmals nicht möglich und es bleibt lediglich der Weg von Saunders‘ über einen Abgleich der Realität mit Modellierungen.
Wirtschaftliches Wachstum bedeutet für viele Menschen neben einem höheren Energieverbrauch eben auch höhere Standards in medizinischer Versorgung oder Teilhabe an der Gesellschaft über Kommunikationsmedien. So werden in Irland bei Haushalten mit geringem Einkommen Rebound-Effekte von 70 Prozent aufgrund von Komfortzugewinnen angenommen. Die tatsächlichen Gründe sind vielfältig. Sie reichen von finanziellen Gründen über fehlendes Wissen zur richtigen Nutzung bis hin zu psychologischen Gründen, wie etwa moralische Lizenzierung.
Warum Detektivarbeit lohnt: Auch Energieeffizienz hat ein Motiv
Die zu hohe Stromrechnung kommt postwendend bei uns als Verursacher an. Auswirkungen von Flugreisen oder „verschwendeter“ graue Energie sind meistens irgendwo da draußen und bleiben uns verborgen. Ein wichtiger Punkt bei Rebounds ist das Sensibilisieren für die Auswirkungen des eigenen Handelns. Wenn sich die Menschen konsequent mit Energieeffizienz auseinandersetzen, können anstatt Rebounds auch positive Effekte auftreten. Diese werden dann als Suffizienz und Spill-Over bezeichnet.
Suffizienz als Gegenstück zu direkten Rebounds bezieht sich auf den jeweils gleichen Bereich: Der Kauf von LED-Leuchten bringt auch eine Verhaltensänderung bei der Beleuchtung mit sich und der effiziente Kühlschrank darf sich im Familienurlaub ebenfalls ein paar Wochen ausruhen. Spill-Over-Effekte stehen den indirekten Rebounds gegenüber: Etwa, wenn eine sparsame Waschmaschine auch zum Einbau einer wassersparender Toilettenspülung anregt.
Rebound-Effekte stellen Energieeffizienzprogramme nicht generell infrage: Selbst 60 bis 70 Prozent an ungenutztem Effizienzpotential sind weniger als 100 Prozent. Die Verbesserung der Dampfmaschine war rückblickend ein Faktor, der aus einer Umwelt- und Klimaschutzperspektive zu vielen Problemen geführt hat – aus wirtschaftlicher Perspektive war sie ein großer Gewinn. Eine niedrigere Stromrechnung ist in erster Linie günstiger als eine hohe. Die indirekten Kosten (und der indirekte Nutzen) für eine Gesellschaft werden oftmals erst dann klarer, wenn sie wieder auf uns zurückfallen.

Studien und Publikationen zum Thema
- Studie im Auftrag des Umweltbundesamts zu Rebound-Effekten (2016)
- Podcast des Umweltbundesamts zum Rebound-Effekt (.mp3-Download)
- Artikel von Michael Golde zum Rebound in der ImpulsE-Zeitschrift (2017)
- Nordhaus: The Energy Rebound Battle (2017, engl.)
- Fawcett: “Identifying the limits of the rebound effect” (2018, engl.)
- Standpunkt im TS-Background von Noll und Langenheld (2018)
- Studie: Gesamtwirtschaftliche Effekte der Energiewende (2018)
- hemenseite von Dr. Tilman Santarius
Veranstaltungen zum Schwerpunkt
Moabiter Energie- und Klimatag
Unternehmensnetzwerk Moabit e.V.
Klimaschutz ist zwar eine globale Aufgabe, muss aber auf allen Ebenen umgesetzt werden – so auch in Moabit. Mit dem mittlerweile 8. Moabiter Energie- und Klima-Tag wollen wir hierfür ein Zeichen setzen: aufklären und informieren und zum Handeln auf lokaler Ebene bei den BewohnerInnen, bei Unternehmen oder öffentlichen Institutionen anregen...
14.09.2019
Programm und Infos
Vernetzungskonferenz Rebound-Effekte
DLR Projektträger Umwelt und Nachhaltigkeit / BMBF
Das Ziel der Konferenz ist es, aufgrund der Forschungen zu thematisieren, wie wir den Rebound-Effekt bewusst und transparent machen und wie wir ihn verringern können. Zur Vorstellung ihrer Projekte und zur Diskussion gemeinsamer Strategien treffen sich die neun Forschungsverbünde erstmals auf der Vernetzungskonferenz „Rebound-Effekte aus sozial-ökologischer Perspektive" ...
11./12.09.2019 in Bonn (!)
Programm und Anmeldung
Drei Niedrigstenergiehäuser nach 10 Jahren Betriebszeit
Aktionskreis Energie e.V.
Der „Niedrigstenergiehaus- Standard soll für Neubauten die Regel werden. Daher lohnt ein Blick auf die Gebäude, die bereits jahrelange Erfahrung damit haben. Die Architekten erläutern jeweils selbst ihre energetischen und architektonischen Konzepte, und wie sie sich jeweils bewährt haben....
01.10.2019
Programm und Anmeldung
CO2 Neutralität im Alltag – eine Familie nimmt die Herausforderung an
Aktionskreis Energie e.V.
Die Frage nach dem richtigen, fröhlichen aber umweltbewussten Leben in Zeiten des Klimawandels beschäftigt viele: „Wie reduzieren wir unseren ökologischen Fußabdruck?“ Die Familie Pinzler-Wessel hat es ein Jahr lang versucht. Ihre anregenden und mutmachenden Erlebnisse und Recherchen präsentieren sie im Rahmend er Veranstaltung. Ein Weg, der für alle praktikabel ist und wesentlich mehr Spaß macht als Verzicht erfordert...
10.12.2019
Programm und Anmeldung
Themenverwandte Projekte
Where there's muck there's brass
Am 25. August jährte sich der Todestag von James Watt zum 200sten Mal. Als er 1819 starb, war die Industrialisierung in vollem Gange und das Sprichwort „Where’s the muck there’s the brass“ spiegelte sich in der Landschaft wieder. Die Schornsteine mussten rauchen, denn nur dann wurde Geld verdient und Maler reisten eigens nach Manchester, um die besondere Färbung des Himmels einzufangen. Die schwefelig-gelbe Landschaftsromantik war jedoch weit entfernt von den Lebensbedingungen der Fabrikarbeiter und -arbeiterinnen.
Die indirekten Kosten der rauchenden Schornsteine auf Mensch und Umwelt wurden damals auf drastische Weise deutlich und zum Gegenstand öffentlicher Debatte. Nicht zufällig sind manche Beschreibungen Londons in Charles Dickens' Romanen äußerst plastisch: Er gilt wohl als der bekannteste Chronist der Umweltverschmutzung Englands im 19. Jahrhundert und war neben seinem Engagement gegen soziale Misstände auch ein (erfolgloser) Verfechter eines Clean Air Acts.
Ach ja: Während Sherlock Holmes und Dr. Watson ihren ersten Fall lösten, erblickte auch die erste Solarzelle das Licht der Welt.